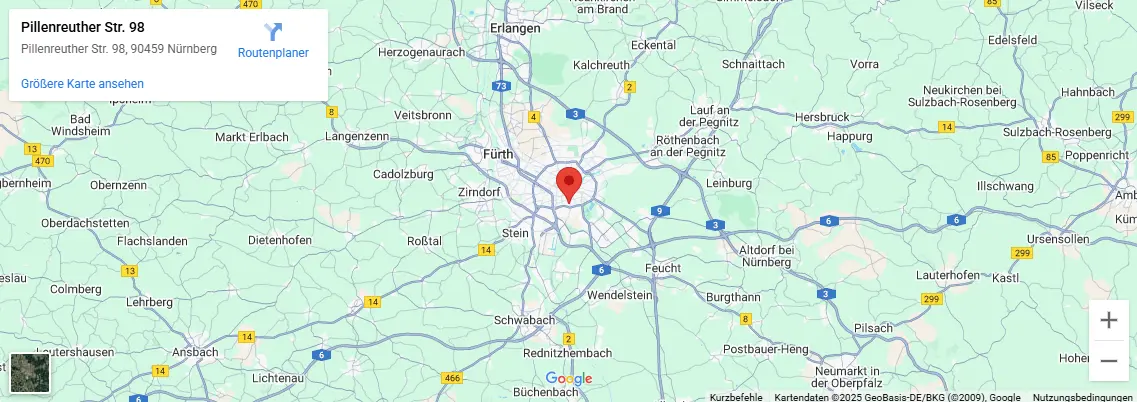Energiespeicherung – das Rückgrat einer stabilen, erneuerbaren Energieversorgung
Die Energiewende steht nicht nur für saubere Energie – sondern auch für ein neues Verständnis von Stromnutzung: Strom wird nicht mehr dauerhaft und gleichmäßig in Großkraftwerken produziert, sondern dezentral – aus Wind, Sonne, Wasser und Biomasse. Diese erneuerbaren Quellen stehen jedoch nicht immer dann zur Verfügung, wenn Strom gebraucht wird. Deshalb brauchen wir Speicher – in unterschiedlichen Formen, je nach Anwendungsfall.
Wie wird Strom gespeichert – und wofür?
Man unterscheidet drei Hauptkategorien der Stromspeicherung – je nachdem, wie schnell der Strom wieder zur Verfügung stehen soll:
Kurzzeitspeicher (Sekunden bis Minuten)
Diese Speicher gleichen schnelle Schwankungen im Stromnetz aus, etwa bei plötzlichem Lastanstieg oder schwankender Einspeisung durch Wind und PV. Zum Einsatz kommen Batteriespeicher, Schwungräder oder Kondensatoren. Sie sorgen für Netzstabilität und die Einhaltung der Netzfrequenz.
Mittelfristige Speicher (Minuten bis Stunden)
Diese Speicher verschieben Energie im Tagesverlauf – z. B. tagsüber erzeugter Solarstrom wird abends genutzt. Beispiele sind Haushaltsbatterien (z. B. Lithium-Eisenphosphat), Netzspeicher, Pumpspeicherwerke oder flexible Biogasanlagen.
Viele Biogasanlagen laufen heute im Dauerbetrieb, um Wärme effizient zu nutzen. Für die Energiewende ist es sinnvoller, sie flexibel zu betreiben – also Strom dann zu erzeugen, wenn Sonne und Wind fehlen. Das erfordert jedoch einen technischen Umbau und eine Anpassung der Förderbedingungen.
Langzeitspeicher (Tage bis Wochen)
Diese Speicher überbrücken längere Zeiträume ohne Wind und Sonne – sogenannte Dunkelflauten. Das ist besonders im Winter wichtig, wenn weniger PV-Strom zur Verfügung steht. Hier kommen Technologien zum Einsatz, die große Energiemengen speichern können – auch wenn sie nur selten benötigt werden.
Eisen-Luft-Batterien – Stromspeicher für mehrere Tage
Eisen-Luft-Batterien basieren auf der reversiblen Oxidation von Eisen – ein günstiger, robuster und leicht verfügbarer Rohstoff. Der Wirkungsgrad liegt bei etwa 50 %, die Kosten sind deutlich niedriger als bei Lithium-Batterien. Ein erstes Großprojekt (150 MWh) entsteht aktuell in den USA. In Zukunft könnten diese Speicher mehrere Terawattstunden Strom für Dunkelflauten bereitstellen – ohne seltene oder giftige Materialien.
Flexibles Biogas – schon heute verfügbar
Biogas ist eine der wenigen erneuerbaren Energiequellen, die dauerhaft Strom erzeugen können. Derzeit laufen viele der rund 9.500 Anlagen in Deutschland im Dauerbetrieb. Sie erreichen dabei Wirkungsgrade von bis zu 90 %. Für die Energiewende ist es sinnvoller, Biogas flexibel einzusetzen – also gezielt bei Strommangel. Dafür braucht es Wärmespeicher, geänderte Förderbedingungen und Netzsteuerung. So könnten rund 1 Terawattstunde Langzeitspeicherkapazität bereitgestellt werden.
Elektroautos – das größte dezentrale Speichersystem
Elektroautos können künftig nicht nur laden, sondern über bidirektionales Laden auch Strom zurück ins Netz geben („Vehicle to Grid“). Wenn 80 % der Pkw elektrisch fahren und 80 % davon netzdienlich eingebunden werden, ergibt sich ein theoretisches Potenzial von rund 1,2 TWh – genug für fast einen ganzen Tag Stromverbrauch in Deutschland. Da die Speicher ohnehin vorhanden sind, ist das eine besonders kosteneffiziente Lösung.
Wasserstoff – notwendig, aber verlustreich
Wasserstoff ist unverzichtbar für Sektoren wie Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. Für die Stromspeicherung ist er hingegen ineffizient. Der Gesamtwirkungsgrad von der Erzeugung bis zur Rückverstromung liegt bei nur 30 bis 45 %. Deshalb sollte Wasserstoff nur eingesetzt werden, wenn andere Speicherformen nicht ausreichen.
Synthetische Kraftstoffe – ineffizient und teuer
E-Methan oder E-Diesel lassen sich zwar gut speichern und transportieren, sind aber extrem ineffizient. Die Herstellung hat einen Wirkungsgrad von nur 20–35 %, die Nutzung im Verbrennungsmotor nochmals 25–30 %. In Summe bleiben oft weniger als 10 % der ursprünglichen Energie nutzbar. Für die Stromversorgung sind solche Kraftstoffe daher nicht geeignet.
Warum der Wirkungsgrad entscheidend ist
Der Wirkungsgrad zeigt, wie viel der eingesetzten Energie wieder nutzbar gemacht werden kann. Ist er niedrig, steigt der Preis pro Kilowattstunde deutlich. Beispiel: Strom für 5 Cent/kWh, gespeichert mit 10 % Wirkungsgrad, ergibt 50 Cent/kWh. Deshalb ist es wichtig, möglichst effiziente Speichertechnologien zu nutzen und Strom idealerweise direkt zu verbrauchen.
Wie viel Speicher brauchen wir?
Für eine fünf Tage andauernde Dunkelflaute benötigt Deutschland rund 7 Terawattstunden Speicherkapazität. Eine realistische Verteilung könnte so aussehen:
Speicherform | Anteil | Menge (TWh) | Realistische Umsetzung bis 2040 |
|---|---|---|---|
Elektroautos (V2G) | 25–30 % | ~2,0 TWh | Ja, bei 80 % E-Autos mit bidirektionalem Laden |
Eisen-Luft-Batterien | 30–35 % | ~2,5 TWh | Ja, bei industriellem Hochlauf |
Flexibles Biogas | 10–15 % | ~1,0 TWh | Ja, durch Umbau bestehender Anlagen |
Kurzzeitspeicher & Netzdienste | 10–15 % | ~1,0 TWh | Ja, durch Batteriespeicher |
Wasserstoff & synthetische Kraftstoffe | 10–15 % | ~1,0 TWh | Ja, aber teuer und ineffizient |
Was bedeutet das für PV-Kundinnen und Kunden?
Wer heute eine Photovoltaikanlage mit Speicher installiert, profitiert doppelt: durch niedrigere Stromkosten und höhere Unabhängigkeit – und leistet gleichzeitig einen aktiven Beitrag zur Energiewende. Ihre PV-Anlage wird Teil eines Systems, das E-Autos, Speicher, Wärmepumpen und flexible Verbraucher vernetzt. So entsteht ein stabiles, erneuerbares Energiesystem der Zukunft.
Wir beraten Sie gerne – technisch, wirtschaftlich und mit Weitblick.
Noch Fragen? Ich bin für dich da.
Ob Wirtschaftlichkeit, Technik oder Förderung – ich erkläre es dir einfach und verständlich.
Öffnungszeiten
Montag–Freitag
10:00–18:00 Uhr
Telefon
+49 178 858-0438